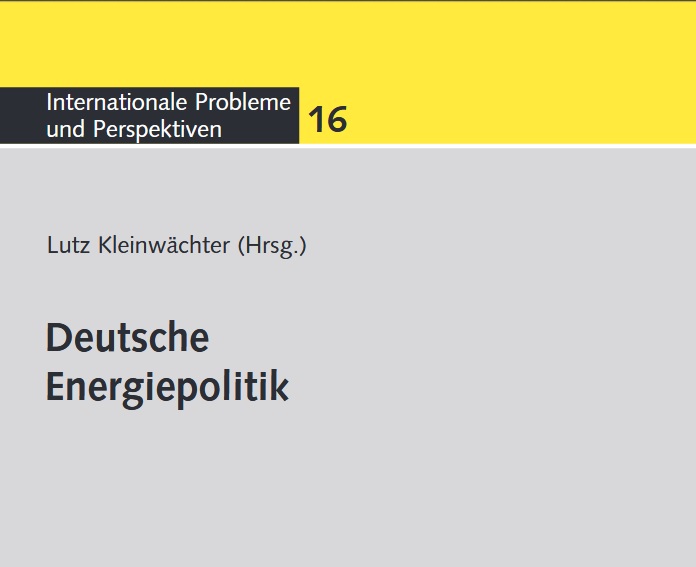Der vorliegende Text ist die Einleitung von Kleinwächter, Lutz (Hrsg.): Deutsche Energiepolitik; Potsdam: Brandenburgische Landeszentrale für politische Bildung 2007.
Das Thema „Energie“ ist in den Schlagzeilen: Energiesicherheit, Energiekrisen und -konflikte, Krieg um Energie, Energiepolitik, traditionelle oder erneuerbare Energien …
Der Verteilungskampf um die globalen Energieressourcen spitzt sich zu. Die Sicherung der Energieversorgung ist eine zentrale nationale und europäische Angelegenheit. Sie entwickelt sich zu einer geopolitischen Herausforderung für die Staaten der Europäischen Union (EU). Gemeinsame Interessen und Handlungsmöglichkeiten erfordern eine kohärente EU-Energiepolitik, eine aktive „Energieaußenpolitik“, die vor einer Reihe strategischer Herausforderungen steht. Die Versorgung der Bevölkerung unseres Kontinents muss langfristig gesichert und zugleich diversifiziert werden, der Klimaschutz ist dabei voran zu bringen. Die Abhängigkeit von einzelnen Energiearten und Bezugsregionen muss vermindert werden. Zur Lösung dieser strategischen Aufgaben brauchen Europa und Deutschland einen regulierten Wettbewerb im Wirtschaftssektor Energie.
Die Zukunft liegt in einem modernen Energie- und Technologiemix. Wie soll dieser aussehen? Sicher werden erneuerbare Energien dabei eine immer größere und unverzichtbare Rolle spielen. Nachhaltige Energiepolitik muss Energieeinsparung, Effizienzverbesserung und technologische Innovation fördern. Energiepolitik wird mehr und mehr zu einer Querschnittspolitik, die eng verflochten ist mit der Wirtschafts-, Verkehrs-, Industrie-, Forschungs-, Umwelt- und Klimaschutzpolitik.
Deutschland hat bei der europäischen Energiepolitik eine Schlüsselstellung inne. Diese Rolle leitet sich ab aus der geografischen Zentrallage in Europa, aus der Wirtschafts- und Technologiekraft, aus dem Stand der Forschung und Entwicklung in den Bereichen der traditionellen und alternativen Energiegewinnung. Die Situation der deutschen Energiepolitik findet ihre Widerspiegelung in dieser Publikation.
In seinem einleitendem Beitrag über Energiesicherheit analysiert Frank Umbach, zentrale Herausforderungen bei der Energieversorgung für Europa und die USA in den nächsten Jahrzehnten. Er geht dabei von einer längerfristig ungebrochenen Bedeutung von Erdöl und Erdgas aus. Kritisch bewertet er die bisher unterschätzte asiatische Nachfrage, die begrenzten Produktionsund Raffineriekapazitäten, mögliche Krisen und Naturkatastrophen, die Energiereserven in politisch instabilen Regionen, den Investitionsbedarf sowie verstärkte Tendenzen der Verstaatlichung. Nachdrücklich plädiert der Autor für eine Energiepolitik der EU, die durch entsprechende nationale Konzepte, unter Einbeziehung eines breiten Sachverstandes der Regierungen, der Ministerien, der Energiekonzerne, der Wissenschaftler und der Verbraucherverbände untersetzt sein sollte.
Roland Götz untersucht die Rolle Russlands bei der Versorgung Europas mit Erdöl und Erdgas und zeigt die gegenseitige (!) Abhängigkeit auf. Russland ist bei der Energieversorgung für die EU, im weit höheren Maße als der Nahe Osten, der wichtigste Lieferant. Andererseits ist Westeuropa Hauptabsatzmarkt für die russischen Energieträger. Nachdrücklich hebt er hervor, dass Deutschland „in Russland einen verlässlichen Großlieferanten gefunden“ hat. Der beschleunigte Ausbau des Pipeline-Netzes ist von zentraler Bedeutung für die Energieversorgung Europas, wie auch für die ökonomisch rentable Ausbeutung der russischen Fördergebiete.
Elisabeth Strecker geht von der These aus, dass das Thema Energie mittlerweile von allen Gesellschaftsgruppen angenommen und durch einen Informations- und Kommunikationswettbewerb geprägt ist. Unterschiedliche Maßstäbe und Prognosen über Vorräte, Reichweiten, Fördermengen und Preise sind typische Felder Interessen bedingter Informationspolitik. Die globale Energiewirtschaft, nationale Interessen und unterschiedliche Qualität der Informationen erschweren den Aufwand, belastbare Informationen zu gewinnen. Die Wissenschaft kann in der Energiediskussion nur begrenzt helfen. Sie ist z.T. selbst Bestandteil des Lobby-Systems. Ziel des Beitrages ist es „Zahlen, Daten und Fakten“, die von Geologen, Konzernen und Institutionen in der Energiediskussion benutzt werden, kritisch zu beleuchten. Die Autorin untersucht Beispiele des Energieverbrauchs, verschiedene Energieträger und soziale Aspekte.
Der Beitrag von Kai Kleinwächter befasst sich mit dem aktuellen Problem der Strommarktregulierung in Deutschland. Ausgehend von einem historischen Abriss werden die finanziellen, organisatorischen und personellen Verflechtungen zwischen der EU, der Bundesregierung, den Bundesländern, den großen Stromversorgern sowie den industriellen Verbrauchern („Eisernes Pentagramm“) dargestellt. Ab den 1980er Jahren führten die EU-Integration, stagnierende Absätze der Energiewirtschaft sowie die Verbreitung alternativer Technologien (insbesondere Blockheizkraftwerke und alternative Energieträger) zur Entstehung neuer Formen der Verflechtung. Die 2005 installierte Netzbehörde sowie die 2008 beginnende Anreizregulierung stellen keine Zerschlagung der Strukturen und keinen Neubeginn staatlicher Regulierung dar, sondern sind eine Weiterentwicklung des bestehenden Regulierungssystem.
Energiepolitik hat in Deutschland zugleich eine landespolitische Dimension, mit der sich Werner Schilling befasst. Das Land Brandenburg besitzt als das Energieland unter den ostdeutschen Ländern besondere Voraussetzungen. Die Energiewirtschaft zählt zu den 16 Wachstumsbranchen des Landes. Die „Energiestrategie 2010“ konzentriert sich auf eine kostengünstige Energieversorgung und Versorgungssicherheit, die Schaffung von Arbeits plätzen sowie einen umweltschonenden Energieträger-Mix und verbrauchernahe Versorgungsstrukturen. Die subventionsfreie Braunkohle ist nach wie vor der wichtigste Energieträger. Vattenfall Europe baut in Brandenburg die weltweit erste Pilotanlage für ein CO2-freies Braunkohlekraftwerk. Darüber hinaus werden über 1/3 des Stromverbrauches durch erneuerbare Energien, hauptsächlich Windenergie, gedeckt.
Im abschließenden Beitrag des Herausgebers werden ausgehend von historischen Einschnitten außenpolitische, ökonomische und militärpolitische Folgen betrachtet. Die Auflösung der Kolonialreiche im arabisch-islamischen Raum und die folgende Auseinandersetzung um ökonomische Unabhängigkeit der entstandenen Öl-Staaten sowie die Aufhebung des Ost-West-Konfliktes schufen ein neuartiges Kräfteverhältnis. Die Situation in Eurasien änderte sich grundlegend. Energiepolitisch ist das sichtbar an der marktwirtschaftlich neuen Rolle Russlands, Chinas und Indiens und den permanenten Krisen in den Energieregionen Arabiens. Die Geopolitik erfährt in der Form der konfliktgeladenen Geoökonomie eine Renaissance. Für militärische Abenteuer der Europäer ist dort kein Raum. Deutschland ist mit einer nachhaltig kooperativen Außenpolitik zur Gewährleistung seiner Energiesicherheit auf dem richtigen Weg.
Für die Hilfe bei der Realisierung dieser Publikation dankt der Herausgeber ausdrücklich Denise Dittrich, die sachkundig und tatkräftig die Texte lektorierte und formatierte, wesentliche Teile der Recherche sowie der Materialzusammenstellung und dokumentarische Aufbereitung übernahm.